 |
Information
Institut IHG/ BOKU über die FWH
Im Rahmen des
EU-LIFE Projektes
wurde das Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement,
Department Wasser - Atmosphäre - Umwelt, der Universität
für Bodenkultur mit der fischökologischen Beweissicherung
betraut. Ende
Dezember 2008 wurde vom Institut eine zusammenfassende
Stellungnahme über die Fischwanderhilfe erarbeitet. Die
Zusammenfassung dient der Beschreibung des momentanen
Ergebnisstands und diverser Rahmenbedingungen. Lesen
Sie hier: Zusammenfassende
Bewertung der Maßnahme Ybbsmündung Die
Umgestaltung der Ybbsmündung wirkt sich grundsätzlich positiv
auf die Fischfauna aus
Im Zuge von Elektrobefischungen im Rahmen des Postmonitorings war
sowohl eine Steigerung der Individuendichte und Biomasse im
donauseitigen Bereich der Maßnahme, als auch eine Zunahme der
Artenzahl in der Ybbs selbst dokumentierbar. Aufgrund
der negativen Bestandsentwicklung der letzten Jahre in der Donau
ist dieses Faktum besonders hervorzuheben. Die Aufweitung der
Ybbsmündung bietet vor allem Jungfischen aufgrund der guten
morphologischen Ausstattung adäquate Habitate und
Aufwuchsbedingungen.
Sowohl bei den Elekrobefischungen als auch bei den
Jungfischerhebungen konnten im neu gestalteten Mündungsbereich
abhängig von den einzelnen befischten Habitaten eine deutliche
Steigerungen der Artenzahl sowie der Individuendichte im Vergleich
zum Prämonitoring festgestellt werden. Von der Neugestaltung der
Ybbsmündung profitieren in erster Linie die rheophilen
Leitfischarten der Donau.
Bei der rheophilen Leitfischart Nase verdreifachte sich die Dichte
im Maßnahmenbereich im Vergleich zur Ybbs. Hervorzuheben ist
auch der Nachweis von insgesamt 8 FFH-Arten: Frauennerfling,
Huchen und Schied, Huchen, Schied, Frauennerfling, Koppe,
Schrätzer, Streber, Weißflossengründling und Zingel.
Anhand der Bewertung nach dem Fish Index Austria lässt sich
ebenfalls die positive Entwicklung der Ybbsmündung nach der
Umgestaltung demonstrieren. Bei Sommerterminen kommt es zu einer
Verbesserung um eine Zustandsklasse, ausgenommen die Beprobung Mai
2007. Letzteres kann dadurch erklärt werden, dass die
Fertigstellung der Maßnahme noch nicht weit zurück lag und daher
noch keine Überformung erfolgt war.
Der niedrige Wert der fischökologischen Zustandsbewertung im
Winter ist keineswegs negativ zu sehen, da sowohl die Ybbs als
auch der Maßnahmenbereich selbst keine klassischen Winterhabitate
sondern nunmehr neue und ideale Flachwasser-Reproduktionsareale
darstellen. 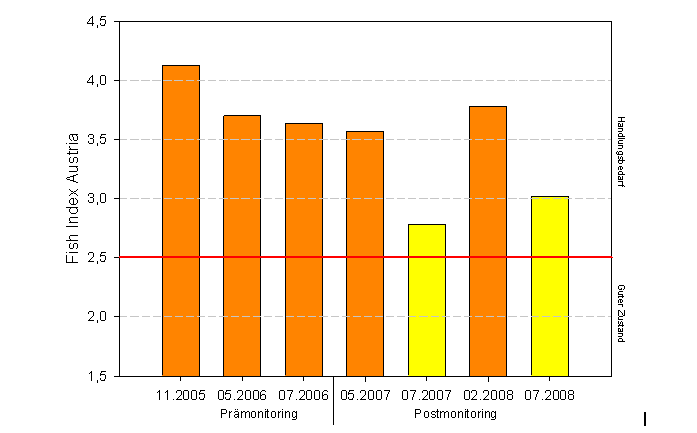
Abb.
1: Bewertung Maßnahme Ybbs-Mündung nach dem Fish Index Austria -
Übersicht Prä- und Postmonitoring
(ohne Verwendung des ko-Kriteriums Biomasse) Zusammenfassende
Bewertung der Funktionsfähigkeit der Fischwanderhilfe Melk Allgemeines
Regulierungen und Kraftwerke, aber auch zunehmende Nutzung der
Donau als Schifffahrtsstraße sowie relativ neue Einflüsse - wie
stark steigende Zahlen verschiedener Fischfresser und/oder neue
invasive Einwanderer (Grundeln) - haben in den letzten Jahren
dramatisch rückläufige Fischbestände im Bereich der gesamten
österreichischen Donau und deren Zubringern (v.a. in den
Unterläufen) zur Folge. Dem Aspekt "Vernetzung" kommt
dadurch hinsichtlich Wiederbesiedlung revitalisierter Abschnitte,
genetischem Austausch sowie Ausgleich von Populationsschwankungen
ein besonderer Stellenwert zu.
Zielsetzung
Im Rahmen des EU-Life Natur Projektes "Vernetzung
Donau-Ybbs" wurde neben der Neugestaltung der Ybbsmündung
als zweite wesentliche Maßnahme die Errichtung einer
Fischwanderhilfe (FWH) beim Donaukraftwerk Melk verwirklicht. Die
Errichtung von FWHs hat in Österreich eine lange Tradition und
ist zusammen mit Restaurationsmaßnahmen, wie im Bereich der
Ybbsmündung, als bedeutende Maßnahme zur Wiederherstellung der
ökologischen Funktionsfähigkeit von Fließgewässern im Sinne
der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu betrachten.
Die Überprüfung der Funktionalität neu gesetzter Maßnahmen
stellt dabei ein wichtiges Instrument im Rahmen der
gesamtheitlichen Beurteilung von Fließgewässer-Ökosystemen dar.
Zum Konzept der Fischwanderhilfe
Im Zuge der Vorarbeiten zur Planung der Fischwanderhilfe am
Donaukraftwerk Melk wurden von einem Expertenteam grundsätzliche
Lösungsmöglichkeiten analysiert und abgewogen. Das Team umfasste
Vertreter Technischer Büros, der Fischerei, des
Kraftwerksbetreibers (AHP) sowie der Universität für Bodenkultur
Wien. Die aus den eingehenden Diskussionen resultierenden
Varianten für die neue FWH wurden in einem ersten Schritt auf
ihre technische Machbarkeit und anschließend mit Hilfe einer
Zielmatrix auf ihre potentielle ökologische Funktion hin
bewertet. Dabei wurden als Einzelziele die Vernetzung
(qualitativer Aufstieg bezogen auf Artenspektrum und
Entwicklungsstadien), der quantitative Aufstieg (Anzahl
aufsteigender Individuen) und die Eignung der FWH als Lebensraum
unterschieden. Zusammenfassend konnte keine Anlage (Variante)
entsprechend der angeführten Bewertung alle mit als
"wichtig" eingestuften Ziele in vollem Umfang erfüllen.
Als fischökologische Ideallösung wurde daher von allen
Beteiligten der Bau von 2 FAH's sowohl am linken als auch am
rechten Ufer angesehen, da nur diese Lösung alle
Zielformulierungen der Zielmatrix erfüllen würde. Im konkreten
Fall war dies aufgrund der Kostensituation im LIFE Projekt nicht
möglich, weshalb die Entscheidung für eine Variante getroffen
werden musste. Letztlich war das Ergebnis dieses
Diskussionsprozesses die Entscheidung für die Variante
"Umgehungsbach mit Einstieg am linken Ufer". Die
Gesichtspunkte Vernetzung und Wanderung wurden dabei durchgehend
mit "gut" bis "sehr gut" beurteilt.
Hinsichtlich der Wanderungen juveniler Individuen sowie von
Vertretern der stagnophilen und indifferenten Gilde wurde diese
Lösung als "sehr gut" eingeschätzt. Dem
Vernetzungsaspekt für alle Arten und Alterstadien wurde dabei
unter den herrschenden Rahmenbedingungen eine etwas höhere
Priorität als der Fokussierung auf die Laichwanderung der
rheophilen Leitfischarten eingeräumt. Die Entscheidung erfolge
somit auch unter dem Gesichtspunkt, dass aus den diskutierten
Varianten eine Wahl getroffen werden musste und Laichwanderungen
der rheophilen Arten am linken Ufer keinesfalls auszuschließen
seien. Die Wachau mit ihrer vergleichsweise guten strukturellen
Ausstattung liegt im Unterwasser des Donaukraftwerkes Melk und
repräsentiert zusammen mit dem Abschnitt östlich von Wien die
beiden letzten Fließstrecken des gesamten österreichischen
Donauabschnittes. Die Tatsache, dass es sich auch bei der Donau
flussauf des Kraftwerks Melk um eine Staukette handelt, wo für
die Rheophilen Laichplätze und Lebensräume derzeit nur sehr
eingeschränkt vorliegen, war mit ein wesentliches Argument, der
linksufrigen Variante den Vorrang zu geben. Positiv bewertet wurde
schließlich auch die Eignung des Umgehungsbaches als Lebensraum.
Generell wurde für diesen FWH-Typ unter der Voraussetzung
entsprechender baulicher Ausführung hohe Funktionalität und eine
längerfristig günstige Habitatausstattung bescheinigt.
Überprüfung der Fischwanderhilfe
Ziel der Funktionskontrolle war es, zu untersuchen, ob und für
welche Arten die Fischwanderhilfe am Kraftwerk Melk auffindbar und
überwindbar ist. Zur Überprüfung kamen sowohl Reusenanlagen als
auch periodisch durchgeführte Elektrobefischungen in der FWH
sowie in der Donau selbst zum Einsatz. Telemetrische
Untersuchungen mit Nasen und Huchen sollten die Untersuchungen
ergänzen. Bei den Befischungen im Unterwasser konnte generell nur
eine sehr geringe Artenzahl als auch Individuendichte festgestellt
werden. Speziell die typischen Leitfischarten der Donau, Barbe und
Nase, lagen im Vergleich zu früheren Untersuchungen in nur mehr
"drastisch reduzierten" Dichten vor. Bereits im Rahmen
des EU-Life Projektes "Lebensraum Huchen" errechnete
sich für die Jahre 2002/2003 mithilfe von Fang/Wiederfanganalysen
für die gesamte Wachau ein Bestand von nur mehr rund 4500 adulten
Nasen. Seit diesem Zeitpunkt ist ein weiterer dramatischer
Rückgang bei den Laichzügen in die Pielach dokumentiert. Allein
an dieser Tatsache wird deutlich, dass mittlerweile der Bestand
dieser ehemaligen Massenfischart stark bedroht ist. Im Rahmen des
fischökologischen Monitorings an der FWH Melk konnte ein
Arteninventar von 42 Fischarten (35 Arten davon durch
Reusenfänge) festgestellt werden (vgl .Kap 4.3.2). Bei einem
dokumentierten aktuellen Arteninventar der Wachau von 40
Fischarten kann damit bezüglich der qualitativen Passierbarkeit
flussaufwärts von einer hohen Zielerfüllung gesprochen werden.
Dies gilt insbesondere, wenn man die Seltenheit einzelner
Fischarten, den aktuell insgesamt geringen Fischbestand der Donau
und den kurzen Zeitraum der Untersuchung berücksichtigt. Die
Passierbarkeit für juvenile Individuen ist ebenfalls für viele
Arten belegt. Vertreter aller ökologischen Gilden wurden
vorgefunden und belegen die grundsätzliche Funktionsfähigkeit.
Auch acht Fischarten, Schied (Aspius aspius),
Weißflossengründling (Gobio albipinnatus), Frauennerfling (Rutilus
pigus), Koppe (Cottus gobio), Schrätzer (Gymnocephalus schraetzer),
Streber (Zingel streber), Zingel (Zingel zingel) und Perlfisch (Rutilus
frisii meidingeri), welche als Schutzgüter nach Anhang II der
Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH-RICHTLINIE 92/43/EWG 1992)
ausgewiesen sind, wurden im Rahmen des fischökologischen
Monitorings nachgewiesen. Die am häufigsten gefangene Fischart
war die Laube, gefolgt von Flußbarsch, Rotauge und Aitel. Nase
und Barbe, die im Melker Donaubereich traditionell in den
Zubringern Pielach und Melk starke Laichzüge aufwiesen, fanden
sich interessanter Weise zur Laichzeit im FWH-System nur
vereinzelt, konnten hier hingegen häufiger bei den sommerlichen
E-Befischungen in Form adulter und juveniler Exemplare
nachgewiesen werden. Im Sommer 2007 wurde auf Grundlage der
Elektrobefischung im unteren Bereich der FWH eine Individuendichte
von rund 2550 Ind./100m errechnet. Es dominierte die Laube mit 957
Ind./100 m, gefolgt von Flussbarsch (367 Ind./100 m), Rotauge (352
Ind./100 m) und Schied (233 Ind./100 m). Die Leitfischarten Barbe
(187 Ind./100m) und Nase (76 Ind./100m) konnten in allen
Altersklassen nachgewiesen werden. Im Jahr 2008 stellte die
Schwarzmundgrundel mit einem Anteil von 34,1 % am Gesamtfang, die
am stärksten vertretene Fischart in diesem Bereich dar, gefolgt
von Rotauge mit 9,1 %, Barbe, Nase und Nerfling mit jeweils 7,7%.
Die Individuendichte sank auf 338 Individuen pro 100 m. Während
der Wintermonate bis in das späte Frühjahr hinein kam es in
beiden Jahren zu einer starken Abnahme der Artenzahl und
Individuendichte. 2009 konnten im Mai 21 Fischarten nachgewiesen
werden. Die Laube stellte die Art mit der höchsten
Individuendichte, gefolgt von Bachforelle und Aitel. Im Juli 2009
stieg die Artenzahl auf 30 an, die höchste Dichte wurde im
Einstiegsbereich der Fischwanderhilfe festgestellt. Die Leitarten
Barbe, Hasel, Laube, Nase und Nerfling kamen in der gesamten FWH
vor. Besonders im Einstiegsbereich der Fischwanderhilfe wurden,
belegt durch die Elektrobefischungen, immer wieder
"relativ" hohe Dichten der Leitarten Barbe und Nase
festgestellt. Der Anstieg des Arteninventars und der
Individuendichten erfolgte interessanterweise erst nach der
Hauptlaichzeit der meisten Cypriniden, sodass hier von starken
Sommerwanderungen auszugehen ist. Während der eigentlichen
Laichzeit erfolgen die Züge der Donaufische im Projektsgebiet
offensichtlich weiterhin traditionell v.a. in die Zubringer
Pielach und Melk, was als Indiz für stark ausgeprägtes "homing"
anzusehen ist. Die Intensität der Laichzüge in die Zubringer ist
jedoch gegenüber Untersuchungsergebnissen vor etwa 10 Jahren
heute deutlich geringer. Auffindbarkeit und Eignung des
Einstiegsbereiches der Fischwanderhilfe sind aufgrund vorliegender
Ergebnisse v. a. zufolge der starken sommerlichen Einwanderungen,
durchaus als gewährleistet anzusehen. Bei der im Rahmen des
Projektes durchgeführten Telemetriestudie mit 50 markierten Nasen
wurden sowohl in der Nähe der Wehranlage, als auch in Nähe des
Einstiegbereiches in die FWH vereinzelt Nasen geortet, es konnten
aber in beiden Bereichen keine größeren Ansammlungen besenderter
Fische festgestellt werden. Vereinzelte Ortungen vor dem Wehr
erfolgten dabei während der Laichzeit, Ortungen im Bereich des
FAH Einstieges nach der Laichzeit. Dies könnte auf differenzierte
Wanderbewegungen hindeuten, mit Laichwanderungen tendenziell in
Richtung der Hauptströmung auf das Wehr zu. Von den im Bereich
des FAH-Einstieges georteten Fischen wanderte kein einziger in die
FAH ein. Bis April 2008 wanderten hingegen 15 besenderte Nasen zu
den Laichgründen in die Pielach und belegen damit die Bedeutung
von frei passierbaren Zubringern für die Reproduktion. Während
des restlichen Jahres wurden von den Nasen vornehmlich die neu
geschaffenen Schotterstrukturen in der Wachau besiedelt. Das 1982
fertiggestellte Kraftwerk Melk unterbindet seit fast drei
Jahrzehnten die früher "donau-typischen" Wanderungen
der Nase, wobei das sogenannte "homing" (Rückkehr der
laichreifen Fische an ihren Geburtsort) in flussauf des Wehres
gelegene Bereiche verloren gegangen ist. Der Verlust der vormals
typischen Laichwanderungen innerhalb der Donau ist als wesentliche
Ursache für die deutlichen Bestandeseinbrüche zu sehen. Die
verbliebenen Restbestände können lediglich die nahegelegenen
Laichhabitate nutzen. Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen,
dass immer ein Teil der Population auf der Suche nach neuen
Habitaten ist, was grundsätzlich der Erschließung neuer Habitate
für den Populationserhalt dient. Dieses Phänomen trägt zur
ökologischen Effektivität der Wiederherstellung des Kontinuums
in Flüssen bei. Von den mit Sendern versehenen drei Huchen
konnten keine Ortungen im unmittelbaren Bereich des Kraftwerks
Melk erfolgen. Zwei Huchen zogen im Frühjahr während der
Laichzeit in die Pielach, wobei ein Fisch anschließend 4 FWHs
durchwanderte, die im LIFE Projekt "Lebensraum Huchen"
zwischen 1999 und 2004 errichtet worden waren. Fischaufstiegshilfe
als Lebensraum
Die Besiedelung der FWH erfolgt sowohl vom Unter- als auch vom
Oberwasser her. Es handelte sich hierbei in erster Linie um
juvenile/subadulte Individuen sowie diverse Kleinfischarten,
welche die FWH als Lebensraum nutzen. Auf Grund bereichsweise
hoher Dichten früher Brutstadien ist auch von natürlicher
Reproduktion einiger Arten innerhalb des FWH Systems auszugehen.
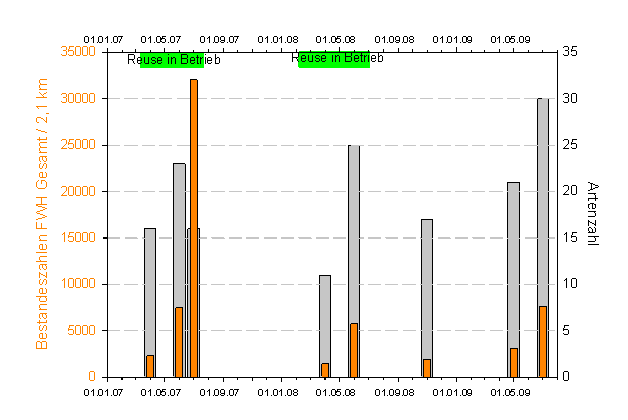 Abb.
2: Zahlen des Gesamtfischbestandes (orange) und Artenanzahl (grau)
für die gesamte FWH und den gesamten Untersuchungszeitraum
(errechnet auf Grundlage der Elektrobefischungen) sowie zeitlicher
Betrieb der Reusen (grün).
Abb. 2 stellt die im Rahmen der Elektrobefischungen errechneten
Fischbestandeszahlen sowie Artenzahl für das gesamte FWH-System
dar. Besonders in den Sommermonaten kommt es in der FWH z.B. mit
rund 32.000 Individuen im Juli 2007 (16 Arten) zu erheblichen
Dichten, verglichen mit den höchsten Dichtewerten wie z.B. der
Ybbsmündung. Generell findet ab Juni/Juli bedingt v.a. durch
viele juvenile Individuen ein Anstieg der Dichten in der gesamten
FWH statt. Auch die Artenzahl nimmt tendenziell zu. Diese Tendenz
ist in jedem Untersuchungsjahr feststellbar, unabhängig ob die
Reusenanlage in Betrieb war oder nicht. Blockade-Effekte
bezüglich der Einwanderung in die FWH durch die Reusenanlage
(Betriebszeit siehe Abb. 2) sind daher eher nicht wahrscheinlich
und aufgrund der Daten jedenfalls nicht belegbar. Geprägt ist die
gesamt FWH durch starke saisonale und jährliche Fluktuationen der
Besiedelung. In der kälteren Jahreszeit dominieren rhithrale
Vertreter und Neogobien, im Sommerhalbjahr Vertreter der
donautypischen Fischfauna.
Zusammenfassung
Fischökologische Monitoringprogramme erfolgen meist unmittelbar
nach Fertigstellung der Maßnahmen, wodurch sich keine
Langzeiteffekte der Wiederherstellung des Kontinuums erfassen
lassen. Offensichtlich ist nach Sanierung alter
Kontinuumsunterbrechungen vor allem bei potamalen
Flussabschnitten, insbesondere bei anthropogen bedingten geringen
Fischdichten, mit einer eher nur langsamen Zunahme wandernder
Fische bzw. Wiederherstellung typischer populationsdynamischer
Prozesse zu rechnen. Im Falle der seit 1982 bestehenden
Kraftwerksanlage Melk ist nach den bisherigen Befunden mit der neu
errichteten FWH die Vernetzung der Fischbestände von Ober- und
Unterwasser für ein breites Artenspektrum auf jeden Fall
gesichert und kann daher als "qualitativ weitgehend
funktionsfähig" bewertet werden. Damit ist das im Rahmen des
LIFE Projekts "Vernetzung Donau-Ybbs" gesteckte
Hauptziel erfüllt und umgesetzt. Die quantitative
Funktionsfähigkeit ist derzeit aufgrund des geringen
Fischbestandes und niedriger Zahl wanderwilliger Fische nicht
abschätzbar bzw. bewertbar. Sollten sich auf Grund umfangreicher
Restaurationsmaßnahmen in der Wachau wieder erstarkte
Fischbestände einstellen, dürfte dies letztlich auch wieder zu
quantitativ verstärkter Wanderung bzw. erhöhter Durchwanderung
des FWH-Systems führen. Für einige Arten kann dabei durchaus
auch die Neuentstehung lokaler Populationen mit entsprechendem
"homing" erwartet werden.
|